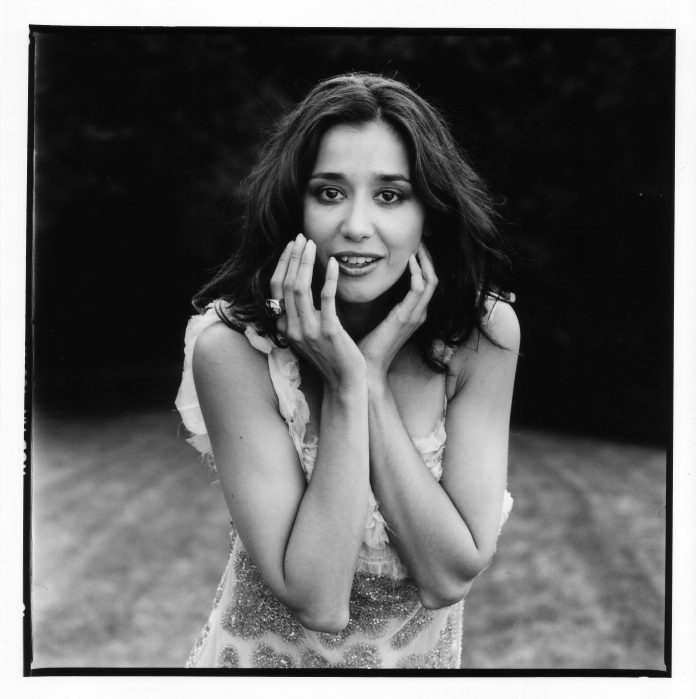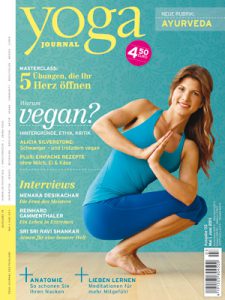Im Frühjahr fallen traditionell eine Menge Aufgaben in Haus und Garten an. Hier müssen Fenster geputzt, dort Unkraut gejätet werden. Diese Asanas wirken ausgleichend.
Haben Sie einen Garten oder Balkon, den Sie liebevoll pflegen? Dann kennen Sie das bestimmt: Arbeit in der Natur mit Erde und Pflanzen macht zwar Freude – aber was, wenn Rückenschmerzen, verspannte Schultern und steife Hüften einen dazu zwingen, Däumchen zu drehen statt den grünen Daumen zu schwingen?
Damit es dazu gar nicht kommt, empfiehlt die Yoga-Lehrerin Veronica d’Orazio in ihrem bislang nur auf Englisch erschienenen Buch „Gardener’s Yoga“ (Sasquatch Books, ca. 16 Euro) drei verschiedene Übungsreihen: Die erste Yoga-Session wärmt den Körper vor der Gartenarbeit sanft auf und bringt Beweglichkeit genau dorthin, wo sie am nötigsten ist – in Hüften, Leisten, Schultern und unteren Rücken. Die Yoga-Pause zwischendurch lockert die Wirbelsäule mit einigen einfachen Stehhaltungen. Und wenn Schaufel und Gießkanne nach getaner Arbeit schließlich weggelegt werden, rät d’Orazio zu einer Verwöhnsequenz im Liegen. Dabei werden die Spuren der Anstrengung mit Hilfe der Schwerkraft weggezaubert, die Gärtnerin verbindet sich mit ihrem Atem und sich selbst und ist danach bestens eingestimmt für eine Meditation im Freien – und den Rest des Tages.
YOGA JOURNAL-TIPP:
Diese Übungssequenzen eignen sich nicht nur hervorragend für Hobbygärtner, sondern auch für eifrige Heimwerker und für alle, die große Putztage im Haus planen. Jeder, der körperlich anstrengende Arbeiten durchführt, wird von diesen kleinen Yoga-Einheiten profitieren. Probieren Sie es aus!
Teil I: Aufwärm-Übungen
Suchen Sie sich einen schönen Platz auf dem Rasen, der Terrasse oder im Haus, wo Sie den Rücken mit sanften Yoga-Übungen aufwärmen beweglich machen können. Achten Sie dabei auf Ihren Atem. „Der Atem ist wie ein Fluss, dem man folgen kann, um den Körper zu öffnen und die Gedanken zu bündeln“, sagt die Buch-Autorin Veronica d’Orazio. „So lassen Sie schon etwas wachsen, bevor sie überhaupt mit der Arbeit beginnen: Achtsamkeit.“
Apanasana (Knie-an-die-Brust-Haltung)
Diese Übung dehnt sanft den unteren Rücken und die Hüften. Zugleich werden die Muskeln rund um die Knie aufgewärmt – eine gute Vorbereitung auf Arbeiten in der Hocke. Legen Sie sich auf den Rücken und ziehen Sie die Beine an, die Hände sind über den Knien verschränkt. Atmen Sie ganz natürlich und lassen Sie dabei Hüften und Schultern zu Boden sinken. Achten Sie darauf, dass Nacken, Kreuzbein und Wirbelsäule möglichst flach auf dem Untergrund ableigen. So wird der Rücken für 7 bis 10 tiefe Atemzüge auf seiner gesamten Länge gedehnt.
Katze-Kuh
Katze-Kuh mobilisiert die Wirbelsäule in ihrer natürlichen Rundung und regt die Flüssigkeitsversorgung der Bandscheiben an. Das macht den Rücken beweglich und geschmeidig. Sie beginnen im Vierfüßerstand, Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften. Ziehen Sie den Nabel sanft nach innen und strecken Sie den Rücken vom Scheitel bis zum Steißbein in die Länge. Beim nächsten Einatmen schieben Sie das Steißbein nach oben, lassen den Bauch nach unten sinken und heben den Kopf. Atmen Sie tief durch den gesamten Körper. Beim Ausatmen machen Sie den Rücken rund, ziehen den Nabel kräftig nach innen und lassen den Kopf sinken. Üben Sie in fließenden Bewegungen für 10 bis 12 Atemzüge.
Baddha Konasana (gebundene Winkelhaltung)
Um die Beininnenseiten und Hüften für die Garten- und Hausarbeit vorzubereiten, empfiehlt sich eine sanfte Hüftöffnung. Sitzen Sie aufrecht und legen Sie die Fußsohlen aneinander, die Knie fallen auseinander und ziehen nach unten. Wenn sich das für Ihre Knie äußerst unangenehm anfühlt, legen Sie auf jeder Seite ein Kissen oder eine gefaltete Decke unter. Hängen Sie die Zeigefinger an den großen Zehen ein und ziehen Sie die Brust sanft nach vorn über die Füße. Lassen Sie den Rücken möglichst gerade dabei und Ihren Brustkorb nach vorne geöffnet. Dies ist wichtiger, als sich tief nach unten zu beugen. Nehmen Sie sich 7 bis 10 Atemzüge Zeit. Mit jedem Einatmen strecken Sie den Rücken lang, mit jedem Ausatmen geben Sie ein bisschen nach und sinken tiefer in die Haltung hinein.
Text: Kate Vogt
Den ganzen Artikel lesen Sie in unserer Mai/Juni-Ausgabe 2011.